Heidi in Frankfurt
Oper in drei Akten
(für alle, die ihre Kindheit nicht vergessen haben)
frei nach der Erzählung von Johanna Spyri
Text vom Komponisten
opus 35
Abendfüllend
komp. 1961–1963
UA: 28.11.1978
Staatstheater Saarbrücken
Dirigent: Matthias Kuntzsch
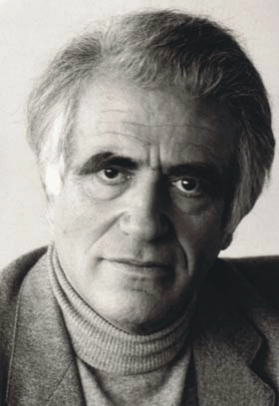
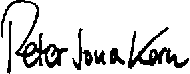 (1922–1998)
(1922–1998)Fräulein Rottenmeier, Gouvernante – Mezzosopran;
Konsul von Sesemann – Bariton; Klara, seine Tochter – Sopran;
Sebastian, Diener – Tenor
[3.2.2.2 – 3.2.2.1 – Pk. Schl. – Hf. Cel. Akk. – Str.]
Peter Jona Korn
ZUR STOFFWAHL EINER OPER
Die Ankündigung, dass Johanna Spyris "Heidi" von einem lebenden Komponisten
zu einer Oper verarbeitet worden ist, hat einiges Aufsehen erregt. In
mehreren Zeitungen erschienen bereits Vorbesprechungen und Glossen über
ein Werk, von dem die betreffenden Rezensenten weder ein Wort noch eine
Note kannten. Abgesehen davon, dass es sich hier um einen Präzedenzfall
handeln dürfte, auf dessen Bedenklichkeit nicht nachdrücklich genug hingewiesen
werden kann, möchte ich diese Umstände zum Anlass nehmen, um über die
Wahl dieses Stoffes, und daran anknüpfend über meine Einstellung zu verschiedenen
Aspekten des zeitgenössischen Opernschaffens im allgemeinen ein paar Worte
sagen.
Die übergroße Bedeutung, die heute dem Libretto zugemessen wird, hat mich
seit langem beunruhigt. Opernwettbewerbe, bei denen die teilnehmenden
Komponisten angewiesen werden, zunächst nur das Libretto einzureichen.
Aufträge, die davon abhängig gemacht werden, welcher berühmte Dramatiker
oder Schriftsteller den Text schreiben wird - das sind Symptome, die ich
für äußerst bedenklich halte, denn abgesehen davon, dass ein lesenswertes
Libretto nicht den geringsten Anhalt für die Qualität der (nachträglich
hinzukomponierten) Musik bietet, erhebt sich die Frage, ob ein brauchbares
Libretto lesenswert sein muss, ja ob es überhaupt lesenswert sein soll?
Denn was sich als Stück, ohne Musik gut lesen lässt, müsste sich auch
in dieser Form gut spielen lassen - wozu also noch Musik hinzufügen?
Ein Theaterstück ist kein Libretto, ein Libretto kein Theaterstück. Gewiss,
es gibt einige - wenige - Fälle von Meisterdramen, die erfolgreich zu
einem Libretto verarbeitet wurden. Und es mag vereinzelte Libretti geben,
die auch als Theaterstücke denkbar wären. Das sind Ausnahmefälle, die
nicht als Norm betrachtet werden dürfen. Das typische Libretto ist ohne
die dazugehörige Musik nicht sinnvoll und als reine Lektüre nicht gut
verdaulich. Kein Zufall, dass die Komponisten (die sich zwar oft für verkannte
Dichter halten, es aber selten sind) so gerne ihr eigenes Libretto schreiben,
denn sie fühlen mit Recht, dass die Konzeption des Librettos und die der
Musik weitgehend voneinander abhängen, ineinander übergehen und, umgekehrt,
miteinander in Konflikt geraten.
Die Dramaturgie der Oper ist von der des Schauspiels grundverschieden;
z. B. wird die feine Pointe eines Schauspiels, sobald sie gesungen wird,
unweigerlich vergröbert, während der in einer Oper überzeugende dramatische
Höhepunkt in einem Schauspiel übertrieben, und daher komisch wirken kann.
Dann sind natürlich die Zeitverhältnisse ganz andere; was nützt es, wenn
man im Libretto eine Folge von Liebesbezeugungen oder Todesschwüren liest,
ohne zu wissen, wie sie in den musikalischen Zeitablauf eingefügt sind?
Handelt es sich gar um den Text einer "Nummer" mit diversen Wort- und
Zeilenwiederholungen, so ist ohne Kenntnis der Partitur eine Vorstellung
von den richtigen Proportionen nicht möglich.
Im zeitgenössischen Musiktheater dominieren drei Librettotypen: an erster
und wichtigster Stelle das sog. "literarische" Libretto, sei es in der
Form eines zurechtgestutzten Meisterdramas oder als dramatisierte Novelle
eines Klassikers. Gelegentlich gelingt hier ein großer Wurf. Aber selbst
bei einem "Wozzeck" oder "Sommernachtstraum" ist es immer schwer zu entscheiden,
ob der Löwenanteil des Erfolgs den Komponisten Berg und Britten oder ihren
"Librettisten" Büchner und Shakespeare gebührt. Trotz meiner Bewunderung
für diese beiden Opern muss ich gerade bei ihnen immer unwillkürlich an
den von Tucholsky geprägten Ausdruck "fremde Muskeln schwellen lassen"
denken.
Die zweite Gattung will ich mit dem Begriff "Stilkomödie" charakterisieren.
Sie verdankt ihre Existenz der Erkenntnis, dass noch die magerste Farce,
die verbrauchteste Situation bei einem verwöhnten Publikum Beifall finden
kann, solange sie nur in der Verpackung eines offiziell anerkannten klassischen
Stils mit entsprechenden Verkleidungen serviert wird (beliebte Schutzmarken:
Griechische Mythologie, commedia dell'arte, Louis XIV).
Schließlich gibt es die Kategorie, die eigentlich an erster Stelle genannt
werden sollte, der aber der Vorrang von den bei den anderen Gattungen
seit längerer Zeit streitig gemacht wird: das eigens für die Opernbühne,
nach Maß angefertigte Originallibretto. Bei den verhältnismäßig wenigen
Originallibretti erfolgreicher Opern der letzten Jahrzehnte lässt sich
die Art des Stoffes gewöhnlich mit einem dieser beiden Adjektiva charakterisieren:
sensationell und skurril. Das ideale Erfolgslibretto des 20. Jahrhunderts,
möchte man fast glauben, erfordert eine geschickte Mischung beider Eigenschaften.
Hier ist wiederum die Gefahr, dass Außergewöhnliches leicht zur Norm werden
kann oder bereits geworden ist. Es ist immer wieder zu beobachten: je
skurriler, je sensationeller das Libretto, desto unwichtiger wird die
Qualität der Musik. Der Schwerpunkt des Wortes Musiktheater wird von "Musik"
auf "Theater" verlegt. Wort und Handlung herrschen, die Musik begleitet.
Man geht heute Opern "sehen". Ich meine, man sollte doch eine Oper in
erster Linie hören. Eine gute Oper sollte so beschaffen sein, dass sie
rein durch ihre Musik, also etwa als durch Rundfunksendung. bei Unkenntnis
der Handlung oder in einer dem Hörer unbekannten Sprache, zum Erlebnis
werden kann. Diese Bedingung wird von sämtlichen Opern der Vergangenheit,
die sich ihren Platz im permanenten Repertoire gesichert haben, erfüllt.
Wie viel, nein, wie wenig zeitgenössische Opern können diese Probe mit
Erfolg bestehen?
Es erübrigt sich, zu spekulieren, wie weit die Frage der Dauerhaftigkeit
für Komponisten, Librettisten, Intendanten, Verleger und andere am Erfolg
einer Oper Interessierte überhaupt noch Bedeutung hat. Da es sich gezeigt
hat, dass Opern auf Grund der sensationell-skurrilen Thematik des Librettos
vorübergehend großen Erfolg haben können (Beispiele: Kreneks "Jonny",
Menottis "Konsul", Blomdahls "Aniara") ist es verständlich, dass die Autoren
den schnellen Ruhm eines "Opernschlagers" der äußerst unsicheren Aussicht
vorziehen, dass ihr Werk dank seiner musikalischen Substanz sich allmählich
einen Platz im Repertoire erobert.
Es ist mein persönliches Pech, zu keinem dieser drei Librettogattungen
besondere Zuneigung zu spüren. Beim literarischen Libretto stört es mich,
einen Shakespeare oder Schiller um Hilfestellung zu bemühen, und beim
sensationellen Originallibretto ärgert mich die Aura. von Konjunktur,
die es fast. immer umgibt. Dass ich gegen die "Stilkomödie" schwerwiegende
prinzipielle Bedenken habe, dürfte aus dem Satz hervorgehen, mit dem ich
sie charakterisiert habe.
Als ich vor einigen Jahren begann, mich für einen brauchbaren Stoff zu
interessieren, war ich mir von Anfang an darüber klar, dass er vor allem
die Eigenschaft haben musste, meine Bedenken gegen die derzeit landläufigen
Librettogattungen unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Aber natürlich
kam es nicht in erster Linie darauf an, zu wissen, wie mein Libretto nicht
beschaffen sein sollte.
Allmählich entwickelte ich eine klarere Vorstellung von der Art Oper.
die ich zu schreiben hatte. Als wichtigstes Stichwort schwebte mir der
angelsächsische Begriff "understatement" vor. Sollte es nicht möglich
sein, die in der Oper arg strapazierte "große Geste" durch eine "kleine
Geste" zu ersetzen? Etwa: statt einer durch ein kaiserliches Dekret ausgelösten
Völkerwanderung - die gewaltsame Verpflanzung eines Kindes? Anstelle einer
dunklen Verschwörung maskierter Intriganten - ein Wortbruch, der für ein
solches Kind das Ende der Welt bedeutet? Statt der angeblich unentbehrlichen
Erotik (die ohnehin in vielen Opern der letzten Jahre derart "verfremdet"
worden ist, dass sie eher als eine Parodie der Erotik wirkt!) - Liebe
und Hass in ihren mannigfachen Formen, die außerhalb der sexuellen Sphäre
existieren?
Dann dachte ich an die großen technischen Probleme, die die Produktion
einer neuen Oper fast immer mit sich bringt. Müssen Hauptrollen moderner
Opern tatsächlich so schwierig sein, dass nur hier und da ein Sänger zu
finden ist, der sie lernen kann? Sollte es nicht möglich sein, eine Oper
- ohne die musikalische Substanz im geringsten zu beeinträchtigen - so
zu konzipieren, dass auch an kleineren Bühnen mit den dort zur Verfügung
stehenden Kräften und in den Grenzen des vorhandenen Etats aufgeführt
werden kann? Muss eine Oper (und damit war ich bei dem vielleicht wichtigsten
Punkt meiner Betrachtungen angelangt) auf den spezifischen Geschmack eines
"Premierenpublikums" zugeschnitten sein, das durch jahrelange, systematische
Verfeinerung seiner Geschmacksnerven zu völlig anderen Bewertungen gelangt
als das reguläre Opernpublikum, das sich durch die einfacheres aber gesündere
Kost des Abonnenten-Spielplans noch die Möglichkeit einer spontanen Reaktion
bewahrt hat? (Auf die Diskrepanz zwischen dem Urteil der Kritik und dem
des Publikums brauche ich hier nicht näher einzugehen, auch nicht auf
die bekannte Tatsache, dass es in den meisten Fällen das Publikum war,
das am Ende Recht behalten hat.)
Das Endresultat meiner Erwägungen war der Entschluss, einen Abschnitt
aus Johanna Spyris "Heidi" in ein Libretto umzuarbeiten. Von Anfang an
war ich mir darüber klar, dass es 'Intendanten, Kritiker und Schichten
des Publikums geben würde, die eine Oper, deren Stoff einem Jugendbuch
entnommen ist, a priori als belanglos oder uninteressant ablehnen würden.
Vorurteile treten eben häufig gruppenweise auf, und ich könnte mir kaum
ein Thema denken, gegen das nicht diese oder jene Meinungsgruppe ein Misstrauensvotum
auf Vorschuss - sei es aus politischen, moralischen oder anderen Gründen
- auszudrücken bereit wäre. Das wird gewöhnlich dadurch ausgeglichen,
dass auf der entgegengesetzten Seite auch eine Gruppe steht, die - ebenfalls
ohne das Werk zu kennen - leidenschaftlich dafür agiert.
Ganz unberechtigt wäre ein Vorurteil freilich nicht, wenn es sich hier
z. B. um einen vorübergehend populären "Backfischroman" handelte. Das
ist das Spyri-Buch nun keineswegs; "Heidis Lehr- und Wanderjahre", dem
die Frankfurter Episode, auf der das Libretto basiert, entnommen ist,
erschien 1881 und ist seit einem Dreivierteljahrhundert ein internationaler
Bestseller in einem Maß wie es keinem zweiten Buch der deutschsprachigen
Jugendliteratur beschieden war. Es versteht sich von selbst, dass es sich
bei einem solchen Buch nicht um eine landläufige "Jungmädchenschwarte"
handeln kann, die - nebenbei bemerkt - heute kein Teenager mehr kaufen
oder lesen würde, wäre selbst jemand so geschäftsuntüchtig, sie noch zu
verfassen oder zu verlegen. Die "Heidi" aber zieht, von Neuauflage zu
Neuauflage, in vielen Übersetzungen unbekümmert ihres Wegs, so dass man
fast glauben könnte, sie habe. sich für immer in der Weltliteratur festgesetzt!
Über die literarische Geltung der Heidi-Autorin in diesem Rahmen nähere
Betrachtungen anzustellen, wäre verfehlt. Die Volksdichterin Johanna Spyri
jedoch an die Seite der Marlitt zu stellen, wäre genau so töricht, wie
Friedrich Silcher und Paul Lincke in einen Topf zu werfen.
Aber ich darf nicht vergessen, dass schon das Wort "Volksdichterin" in
Deutschland ungern gehört wird, da es - wie alle Zusammensetzungen mit
dem Wort Volk - hier seit 1945 als peinlich empfunden wird. Zu allem Unglück
habe ich "Heidi" noch selbst als Volksoper bezeichnet, und es ist Seiten
des Verlags auf die "volkstümliche" Qualität der Musik hinge-wiesen worden,
was einem Kritiker Anlass zu der Feststellung gab, dass "Volkstümlichkeit"
heute nur noch in den niederen Denkkategorien Realität besitzt. Da haben
wir es.
Ähnlich ist es mit der "Heimat". Beide Begriffe haben im Vokabularium
der Nazis eine große Rolle gespielt, also dokumentiert man Abscheu vor
der Gedankenwelt des Herrn Dr. Goebbels besonders überzeugend dadurch,
dass man so tut, als gäbe sie es nicht mehr. (Es ist nicht ganz verständlich,
warum das dritte Glied dieses Assoziationskomplexes, das Wort "Raum",
nicht gleichermaßen tabu geworden ist - im Gegenteil: es ist den Komponisten
der Avantgarde genau so ans Herz gewachsen wie weiland den Philosophen
des Tausendjährigen Reichs.) Welch merkwürdiges Verfahren, den Geschmack
Hitlers als invertierten Wertmesser anzulegen! Eine Oper, die ihm gefiel,
muss darum noch nicht schlecht, Werke, die er verbieten ließ, müssen darum
noch nicht bedeutend sein. Mit Worten ist es genau so: Volk heißt Volk,
Heimat heißt Heimat, ich denke nicht daran, sie schamerrötend zu vermeiden
oder zu umschreiben,denn sie sind weder von den Nazis erfunden, noch
mit ihnen zu Grabe getragen worden. Wer gar zu ängstlich auf ihrer Vertilgung
beharrt, muss es sich gefallen lassen, dass man argwöhnt, sie seien ihm
einst allzu leicht aus der Feder geflossen oder von den Lippen getropft
-----.
Ein Künstler darf mit Recht stolz darauf sein, dass ein von ihm geschaffenes
Werk "volkstümlich" geworden ist, denn echte Volkstümlichkeit ist kein
Qualitätsubstitut, sondern eine zusätzliche Dimension der künstlerischen
Aussage. Schließlich sind "Zauberflöte" und "Carmen" durchaus volkstümliche
Opern! Nur in einem Lande in dem man eine künstliche Spaltung zwischen
"ernster" und "unterhaltender" Musik ersonnen hat und wo es dann passieren
kann, dass man Meisterwerke als Strafe für ihre zu große Beliebtheit zur
Unterhaltungsmusik degradiert ("bei uns wird Mendelsohn nur noch in der
U-Musik gebracht" erklärte unlängst ein bundesdeutscher Rundfunkabteilungsleiter)
kann dieser Begriff so missbraucht werden!
Mit der "Heimat" ist es eher noch schlimmer, weil diese bewiesenermaßen
in der Literatur der Männerchöre besonders oft und gern besungen wird
(genauso wie die Nacht, der Wald, die Liebe und eine große Anzahl anderer
Worte, die bei einer zusätzlichen "Bereinigung" der deutschen Sprache
dringend berücksichtigt werden sollten!). Für die Spyri, sowie für den
Komponisten, der sie vertont hat, ist das besonders fatal, denn dieser
Begriff spielt hier wie dort eine wichtige, wenn auch weitgehend latente
Rolle. Besser gesagt, das Gegenteil: die Heimatlosigkeit. Das zentrale
Thema der Oper: die gewaltsame Verpflanzung eines Kindes. Gibt es überhaupt
ein realeres, greifbareres Problem in unserer Zeit? Ich wüsste keins.
Es ist mein eigenes Schicksal und, auf ganz andere Weise, das Schicksal,
meiner Kinder, es hat die Lebensform und Denkungsweise vieler meiner Freunde
weitgehend bestimmt, es ist ebenso zeitnah und akut wie das Problem, der
Freiheit, einem Wort, mit dem ebenfalls von politischen Opportunisten
viel Schindluder getrieben wird. Daher musste ich mich über die mehrfach
aufgetauchte Frage wundern, ob meine Oper "parodistisch" aufzufassen sei.
Übrigens: parodieren lässt sich doch nur die Unzulänglichkeit in der Verarbeitung
eines Stoffs,nicht der Stoff an sich! Was in erster Linie zum Parodieren
herausfordert, ist das Unechte, das Gemachte, der Überschwang nicht empfundenen
Gefühle, das falsche Pathos, kurz das, was man in Deutschland gern mit
dem beliebten, aber gefährlichen Schlagwort Kitsch charakterisiert. Da
aber Kitsch sehr vergänglich ist, so ist auch die Zeitspanne, in der es
lohnt,ihn durch das Mittel der Parodie bloß zu stellen begrenzt. Was
wäre billiger, als heute Parodien von Romanen, die vor zwanzig Jahren
populär waren, anzufertigen?
Kitsch ist gewöhnlich Massenware; gelegentlich wird er selbst von den
Kunstexperten als ein quasi offizieller Zeitstil akzeptiert, ehe sie merken,
dass der formale Aufwand in keinem Verhältnis zu der recht bescheidenen
Aussage steht. So ist z. B. die augenblickliche hoch im Kurs stehende
(und in den führenden Galerien hängende) "pop art" ein ganz eklatantes
Beispiel von Kitsch, denn hier offenbart sich die Diskrepanz zwischen
dem Aufwand der Mittel und der faktisch nicht vorhandenen Aussage am eindeutigsten.
Parodistisch ist höchstens hier und da die Musik der Oper, und darüber
möchte ich am liebsten gar nichts sagen, denn die Art und Weise, in der
Musik heute buchstäblich zerredet wird (und zwar mit Vorliebe von den
Komponisten selber) widerstrebt mir sehr. Ich möchte mich darauf beschränken,
festzustellen, dass mir die Thematik gerade dieses Stoffs die Möglichkeit
gab, einige mir wichtige Kommentare zur Musikentwicklung unserer Zeit
mit musikalischen, statt sprachlichen Mittel einzuflechten. Welche davon
als parodistisch zu bezeichnen sind, überlasse ich dem Ermessenen des
scharfsinnigen Hörers. Der Hinweis auf' die Volkstümlichkeit der Musik
ist nicht ganz gefahrlos, weil. dieser Begriff, wie schon bemerkt, allzu
leicht missbraucht wird. Echte Volkstümlichkeit kann natürlich nicht a
priori in Anspruch genommen werden, sondern ergibt sich oder ergibt sich
nicht. Jede fabrizierte Pseudo-Volkstümlichkeit, deren musikalischer Ductus
sich durch die Verwendung unpersönlicher Gemeinplätze verrät, wird hoffentlich
niemand in einer solchen Partitur suchen!
Meine unerschütterliche Überzeugung, dass einer ausgedehnten Periode stilistischer
Experimentierfreudigkeit folgen muss, kommt in dieser Partitur sicher
noch stärker zum Ausdruck als in meinen Instrumentalkompositionen, schon
darum, weil ein stilistisch flexibles Vokabularium bei der Komposition
einer Oper besonders wichtig ist. So gut es sich zwölftönern lässt, während
die Liebhaber mit Messern aufeinander losgehen, so schlecht eignet sich
diese Technik für ihr großes Versöhnungsduett. Eine abendfüllende Oper,
konsequent dodekaphonisch durchgearbeitet, wirkt genau so kontrastlos
und ermüdend wie eine, die sich Takt für Takt im strahlendsten C-Dur sonnt.
Jede Technik hat ihren Sinn und ihre Funktion, in der Oper ganz besonders.
Ich verwende alle musikalischen Mittel, die ich brauche, von der strengsten
Tonalität (die für mich nach wie vor der zwingende Ausgangs- und Endpunkt
alles musikalischen Geschehens ist) über die freie Atonalität bis zur
Dodekaphonie, vom traditionellen Schlusssextett bis zur seriellen Passacaglia
berechtigte Frage: Welche Passacaglia ist eigentlich nicht seriell?),
vom Strophenlied bis zum Jazz. Damit bekenne ich mich offen zur Eklektik,
und glaube, mich dabei in der allerbesten Gesellschaft zu befinden. Denn,
wie der Maler Max Liebermann einmal sagte: Wo die Begabung aufhört, fängt
der Stil an!
Nun noch einige Worte über Fragen der Aufführungspraxis. Wie ich schon
sagte, habe ich bei der Konzeption der "Heidi" durchweg die Möglichkeiten
der kleineren Bühnen berücksichtigt. Um die Besetzung minimal zu halten,
habe ich mehrere wichtige Personen des Spyri-Buches weggelassen. Die "Base
Dete" und "Fräulein Rottenmeier" sind in der Gestalt der letzteren kombiniert
worden. Keine der sechs Gesangsrollen stellt ungewöhnliche Anforderungen;
die beiden Kinder, Heidi und Klara, werden selbstverständlich von Erwachsenen
gesungen - ich habe natürlich niemals daran gedacht, zwei führende Partien
zehnjährigen Opernsängerinnen zu übertragen. und ich war etwas erstaunt,
dass es in diesem Punkt überhaupt Unklarheiten geben konnte. Im Opernbereich,
wo vollbusige Cherubinos und wohlgenährte Florestans wahrhaftig keine
Seltenheit sind und wo es heutzutage als ein besonders genialer Einfall
gelten dürfte, einem schwarz angemalten Othello eine waschecht dunkelhäutige
Desdemona zur Seite zu geben, sollte doch die Illusion, dass zwei graziöse
Sopranistinnen sich plötzlich um zehn Jahre verjüngt haben, wirklich kein
Problem sein!
Die bühnentechnischen Anforderungen sind ausgesprochen bescheiden: jedes
der drei Bühnenbilder lässt sich mit den einfachsten Mitteln realisieren;
eine Drehbühne ist nicht er-forderlich. Die Orchesterbesetzung beschränkt
sich auf den Apparat, der heute jedem Theater zur Verfügung steht. Mit
Ausnahme von einigen Frauenstimmen (hinter der Bühne) wird kein Chor verwendet.
Jeder Künstler hofft, durch das, was er schafft, eine Lücke auszufüllen.
Der Bereich, in dem Übersättigung und Überangebot dominieren, wechselt
ständig. Was heute als Ausnahmefall gegen den Strom schwimmt, kann morgen
bereits von einem Schwarm Epigonen nachgeahmt und dadurch zum Massenerzeugnis
degradiert werden. Genau so, wie man vor einem halben Jahrhundert von
einem "Übermaß an Behaglichkeit reden konnte (gegen das die schaffenden
Künstler mit Recht revoltierten), kann man heute das Gegenteil, ein Übermaß
an Unbehaglichkeit konstatieren, das durch Hinweise auf unsere unbehagliche
Zeit (die vor fünfzig Jahren auch nicht viel behaglicher gewesen sein
dürfte) nicht gerechtfertigt werden kann. Am laufenden Band hergestellter
Zorn ist nicht echter als massenfabrizierte Zufriedenheit. Die Situation
stagniert immer dann, wenn die Künstler das produzieren, was man von ihnen
erwartet. "Eine Oper muss heute….." ist der Ausgangspunkt eines der vertracktesten
Gedankengänge. Da die Anzahl der "repertoirefähigen" Opern, die heute
geschrieben werden, sich ständig in gefährlicher Nähe des Nullpunkts bewegt,
so sind die diversen Richtlinien. die den Librettisten und Komponisten
von wohlmeinenden Opernfachleuten immer wieder auf den Weg gegeben wird,
anscheinend nicht sehr fruchtbar.
Vielleicht wäre es vernünftiger, sich darauf zu besinnen, dass Theorien
über die Richtung, in der die Kunst sich zwangläufig zu entwickeln habe,
selten bestätigt werden, während schaffende Künstler, ihrer inneren Stimme
folgend, entgegen allen dialektischen Prognosen oft zu Resultaten gelangt
sind, die sich als bahnbrechend erwiesen haben. Hans Werner Henze formuliert
es folgendermaßen: "Ein Schritt in unbekanntes Gebiet muss nicht immer
auf technischer Grundlage erfolgen und muss auch nicht unbedingt vorwärts.
gerichtet sein (wer kann sagen, wo vorwärts liegt?). Er könnte sogar Mitteln
unternommen werden, die im Nebel, in der Kurzsichtigkeit der Epoche, verbraucht
scheinen oder "nutzlos"."
Wer kann sagen, in welcher Richtung eine dringend notwendige Erneuerung,
um nicht zu sagen Befreiung, der zeitgenössischen Oper liegt? Ich weiß
keine Antwort auf diese Frage - ich spürte nur, in welcher Richtung ich
nicht suchen durfte. Daher habe ich in allen Phasen des Schaffensprozesses
überlieferte Warnungen und Gebote außer Acht gelassen und bin ausschließlich
meinem Instinkt gefolgt, getreu dem Motto Gustav Mahlers: "Der Verstand
irrt - das Gefühl nie!"
Niederalm, den 4. August 1964
Peter Jona Korn wurde 1922 in Berlin geboren,
wo er schon im frühen Kindesalter durch musikalische Vielseitigkeit und
Begabung auf sich aufmerksam machte. In seinem kompositorischen Schaffen
hat er vor allem unter dem Einfluß Ernst Tochs eine sehr persönliche zeitgemäße
Tonsprache entwickelt, mit der er jedoch an die klassisch-romantische
Tradition anknüpft. Aufgrund seiner Ablehnung doktrinärer Avantgarde-Tendenzen
und seines stets aufrecht erhaltenen Bekenntnisses zu einer erweiterten
Tonalität manchmal als konservativ eingestuft, zeigt Korns Musik bei genauerer
Betrachtung eine die Biographie ihres Schöpfers widerspiegelnde Suche
nach neuen Wegen. Obwohl Korn in erster Linie als Orchesterkomponist gelten
kann, weist er auch ein umfangreiches Schaffen in den “intimeren“ Bereichen
Lied, Kammer- und Klaviermusik auf. Sind seine sinfonischen Werke in vielen
Fällen Bekenntnismusik, so tritt gerade in der Kammermusik oft das absolut
Musikalische in den Vordergrund. Formal - technische Fragen in ihrem Kontext
zwischen historischer Tradition und Herausforderungen gegenwärtiger Entwicklungen
verlangen nach Lösungen, denen Korn in seiner ihm eigenen Weise stets
nachgekommen ist.
Peter Jona Korn was born in Berlin in 1922. From a very early
age onwards he displayed an extraordinary talent and versatility. In his
oevre as a composer and, foremost under the influence of Ernst Toch, he
developed a very personal and contemporary sound language which follows
the classical-romantic tradition, though. Owing to his strong denial of
doctrinarian avantgarde tendencies and his continued commitment to an
extended tonality he was sometimes classified as a conservative. However,
studying Korn’s music in more detail, the continued search for new and
untrodden paths which reflects its creator’s biography shows itself clearly.
Even though Korn might be considered a composer of orchestral music for
the main part, he wrote a substantial number of pieces in the more “intimate”
areas of song, chamber and piano music. While his symphonic music very
often expresses an affirmation of his convictions, his chamber music,
in particular, is ruled by a purely musical pulse. Formalistic issues
in their context between historic tradition and challenges of contemporary
developments call for solutions that Korn has always been able to find
– in his very own language.
